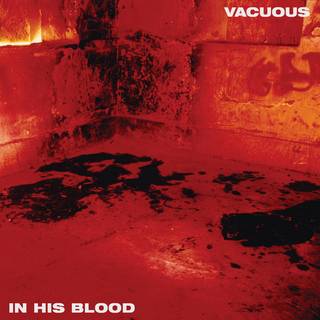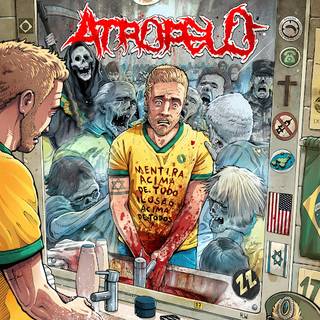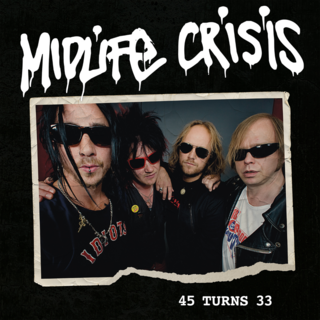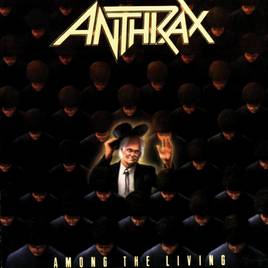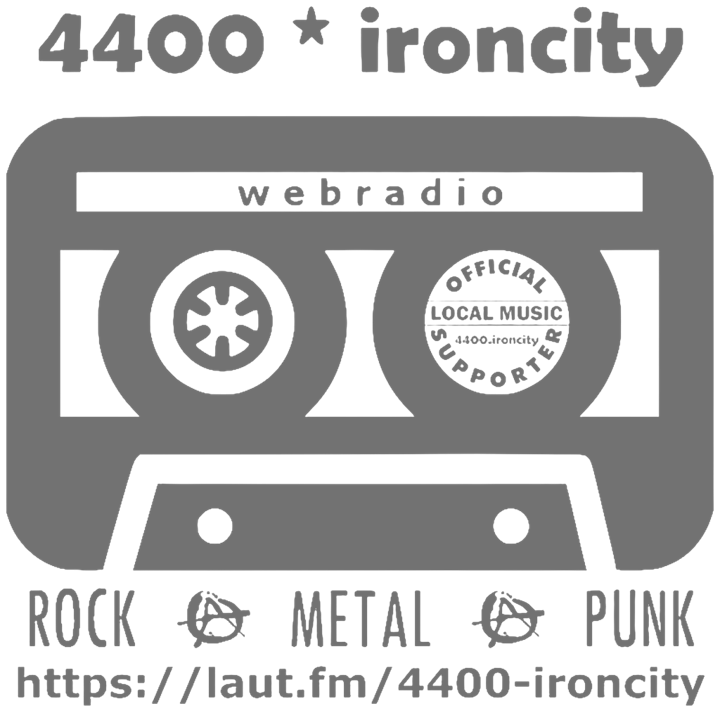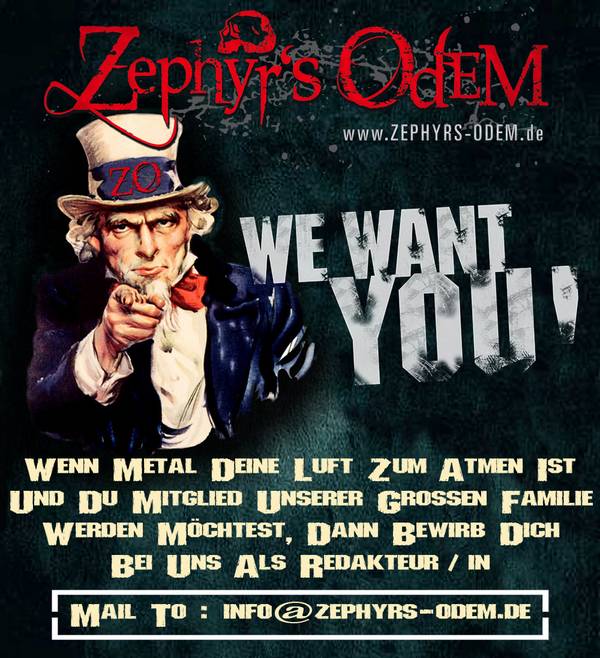HERBST IN DER SCHWÄBISCHEN ALB
Den Auftakt zum eigentlichen Open Air liefern bei leider nicht wirklich feinen Witterungsbedingungen die zu den Stammgästen des Festival zählenden Jungs von Stallion. Sänger Pauly bedankt sich artig beim Veranstalter, der Crew und den Fans und gleich mehrmals für die Chance nach zehnmaligem Besuch auf dem Festival nun erstmals auch auf der Bühne stehen zu dürfen. Der Fünfer weiß diese Chance zu nutzen und gibt von Beginn an Vollgas. Mit seinem Outfit (Skull Fist-Kutte; Hose im „Rising Sun“-Design) ist Pauly auch ein Hingucker, nicht minder beachtenswert ist aber auch das Stage-Acting der Formation, die sämtliche Posen des Rock’n‘Roll-Entertainments drauf hat. Doch was würde das nützen, wenn nicht auch die Musik passen würde? Nicht viel, doch davor sind Stallion gefeit, schließlich wissen die Baden-Württemberger mit ihren tief in den Achtzigern verwurzelten, zum Teil recht hurtig dargebotenen Nummern zu gefallen. Neben dem der sogenannten „Szene“ gewidmeten „Stigmatized“ stechen der Titeltrack ihres ersten Langeisens „Rise And Ride“ und „Wild Stallions“ sowie das Tribut an die Kollegen aus dem Ahorn-Land mit dem unmissverständlichen Titel „Canadian Steele“ hervor. Kurzum, die Burschen erweisen sich als gute Wahl für die Opener-Position und sorgen für ein gepflegtes Aufwärm- und Aufwachprogramm. Logisch, dass sie von der stetig anwachsenden Anzahl an Zusehern mit entsprechendem Applaus dafür honoriert werden. Thumbs Up!
Danach steht die US Metal-Legende Leatherwolf mit Zeremonienmeister Michael Olivieri auf den Brettern und begeistert bei feinsten Sound-Verhältnissen nicht nur die treuesten Fans. Die Triple-Axe-Attack ist ebenso blendend disponiert wie der zuständige Sound-Techniker und nicht zuletzt deshalb verfehlen melodische US Metal-Granaten wie „Gypsies and Thieves“, „Wicked Ways“, „Kill And Kill Again“ oder „Rise Or Fall“ ihre Wirkung auch nicht und werden entsprechend gefeiert. Keine Frage, schon zur Mittagszeit ist ein erstes Highlight zu sehen. Offenbar auch für Petrus, lässt er doch zum ersten Mal die Sonne durch die dichte Wolkendecke blinzeln.
Überraschend kam für viele Fans die Verpflichtung der Kalifornier Babylon A.D., die zwar schon seit zwei Jahren wieder in der früheren aktiv sind, bis dato aber noch nicht in Europa präsent waren. Ihre Hits aus den späten 80ern wie „Back In Babylon“, „Hammer Swings Down“, „Bang Go The Bells“ oder „The Kid Goes Wild“ funktionieren aber immer noch einwandfrei, weshalb die Herren rund um den überaus aktiven und stimmtechnisch in guter Form befindlichen Frontmann Derek Davis auch entsprechend gefeiert werden. Da die Herrschaften mit einem rasanten Tempo und Feuereifer zur Sache gehen, bleibt am Ende sogar noch Zeit einen zusätzlichen Song darzubieten. Die kurze Frage: „Do you like Michael Schenker?“ quittiert die Fanschar mit tosendem Applaus, erst Recht die fulminante Version von UFO’s „Lights Out“ mit der Babylon A.D. ihr Set beenden.
Danach kommt es zur ersten „Völkerwanderung“ vor der Bühne, denn die eher reiferen Semester, die sich nach dem eben erfolgten US-Doppelschlag von dannen machen um sich gegebenenfalls ein wenig Ruhe zu gönnen, geben ihre Plätze an vorderster Front an die etwas jüngere Generation an Metallern frei. Logisch also, dass als nächste mit Battle Beast eine eher dem Zeitgeist entsprechende Truppe die Bretter entert. Zwar fällt klangtechnisch das überpräsente, quäkende Keyboard negativ auf, im Verlauf des Sets kann sich der sein Arbeitsgerät in tragbarer Form ähnlich wie die Saitenfraktion malträtierende Kollege Janne Björkroth jedoch sehr wohl in Szene setzen und für Show-Akzente sorgen. Dennoch bleibt auch er im Schatten von Frontamazone Noora Louhimo, die mit ihrem Auftreten sowie ihrer kratzigen Stimme die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zwar wirkt das Gehabe ein wenig überzogen aggressiv und ihre Stimme in den langgezogenen Tönen etwas angeschlagen, der Stimmung vor der Bühne tut dies aber keinen Abbruch, weshalb die Meute zu Nummern wie „Enter The Metal World“ und vor allem „Fight, Kill, Die“ auch gehörig steil geht. Den Vorschusslorbeeren für ihre Verpflichtung auf der großen Bühne nach dem furiosen Gig beim letztjährigen „Warm Up“ können die Finnen also auf jeden Fall gerecht werden.
Danach geht es wieder mit traditionellem Hard Rock weiter, und das noch dazu in Form einer der momentan wohl heißesten Feger in diesem Genre. Das seit geraumer Zeit erneut umbesetzte „Allstar-Ensemble“ The Dead Daisies lässt es sich selbstredend nicht nehmen erste Auszüge ihres im August erscheinenden dritten Albums vorstellig zu machen, bläst dem Auditorium jedoch zunächst einmal „Midnight Moses“ als Einstieg um die Ohren. Was das Posing betrifft, gibt es das komplette Rockstar-Programm geboten, und nicht nur das, auch die in der alten Rock-Schule fundamentierten Songs kommen grandios rüber und lassen die Qualität dieses Fünfers erkennen. An vorderster Front wuselt der kurzeitige Mötley Crüe und frühere The Scream-Fronter John Corabi in bester Steven Tyler-Manier über die Bretter, während Bandgründer David Lowy an der Gitarre eher den Ruhepol der Formation darstellt. Imposant auch Bassist Marco Mendoza, der nicht nur für einen satten Groove im Hintergrund sorgt, sondern es auch schafft seinen Kaugummi (der den Kaubewegungen nach zu schließen von der Dimension eines Knödels gewesen sein muss) in den Momenten, in denen er zu den Backing Vocals antreten muss, in irgendeiner Ecke seines Rachens zu verstecken und seinen Job tadellos erledigt. Mit Neuzugang Doug Aldrich hat die Truppe ohnehin einen wahren Poser-Gott in ihren Reihen, weshalb für das Auge wahrlich ausreichend gesorgt ist. Dennoch ist es selbstredend seine Fingerfertigkeit die für Furore sorgt und sowohl die bandeigenen Nummern - wie etwa den schwer nach Quiet Riot tönenden Titelsong des kommenden Albums „Make Some Noise“, oder das von Drummer Brian Tichy, der offenbar an den Hocker geschnallt werden musste, um nicht ebenso ständig in Bewegung zu sein wie seine Kollegen geschriebene „The Last Time I Saw The Sun“ - wie auch die Fremdkompositionen prägt. Nach der Show wurde zwar eifrig diskutiert, ob es denn wirklich nötig war gleich drei Cover-Tracks in das Set zu integrieren, doch die Auswahl und erst Recht die Darbietung sollte den „Daisies“ absolut recht geben. Sowohl „All Right Now“, als auch der ebenso auf dem kommenden Dreher verewigte CCR-Klassiker „Fortunate Son“ (CCR) und das Finale in Form einer zwingenden Version von „Helter Skelter“ machen klar, dass Gute-Laune-Hard Rock nicht nur zeitlos ist, sondern in einer solchen Darbietung einfach immer und überall perfekt funktioniert. Und genau das muss man The Dead Daisies auch attestieren, denn dieser Auftritt war schlichtweg in die Kategorie „Großes Rock-Entertainment“ einzuordnen!
Wem es beim traditionellen, im Blues verankerten Hard Rock de Herrschaften zu langsam zur Sache ging, kommt danach auf seine Kosten, steht doch das High-Speed-Melodie-Geschwader Dragonforce auf den Brettern. Die mögen zwar immer noch polarisieren und mitunter gar belächelt werden, an der Tatsache, dass die Jungs mit ihren pfiffigen und pfeilschnellen Nummern sowie ihrem freudestrahlenden Auftreten nicht nur ihre eingeschworene Fans beglücken, gibt es ebenso so wenig zu ändern, wie am Umstand, dass das Schmunzel-Kollektiv längst sämtliche Posen drauf hat und nicht zuletzt deshalb auch mit zu den angesagtesten Bands der Gegenwart überhaupt zu zählen ist. Neben dem mächtigen Finale „Through The Fire And Flames“ erweist sich heute vor allem das längst als programmatisch zu betrachtende „Heroes Of Our Time“ als Abräumer vor dem Herrn und sorgt für prächtige Stimmung. Respekt!
Das Programm in der Messehalle darf Debauchery Vs. Bloodgod mit ihrer „Doppel-Veranstaltung“ eröffnen, zu der ihnen zahlreiche Fans folgen, denen vorwiegend etwas für das Auge geboten wird. Die Monster-Kostüm-Show wirkt wie eine gemeinsamer Auftritt von Lordi und Gwar, und weiß ebenso für Unterhaltung zu sorgen, wie die eher simplen gestrickten, aber ungemein effektiven und für Stimmung sorgenden Tracks der Formation(en). Zwar nicht zwingend notwendig, aber durchaus unterhaltsam.
Ganz im Gegensatz dazu erweist sich die folgende Band auf der großen Bühne als absolute Pflicht. Einzig Petrus schient wenig von Candlemass zu halten, denn während im Laufe des Tages immer wieder die Sonne die dichten Wolken durchbrechen könnte, zeigt sich der alte Knacker während des Gigs der Schweden von seiner wenig charmanten Seite und lässt es mitten im Set der Doom-Kings zu schütten beginnen. Das jedoch ist kein Problem für den sehr agilen und stimmlich topfitten Mats Leven, den weder das Sauwetter selbst, noch die dadurch entstanden plötzliche Flucht der Zuseher vor dem Regen aus der Ruhe bringen kann. Mit einem lapidaren „We are Candlemass, we play Doom Metal, so who needs the sun?“ kommentiert er die Lage ebenso kurz wie bündig, während das Quintett - das immer noch auf Leif Edling verzichten muss, dessen „Burn Out-Syndrom“-Behandlung noch immer nicht abgeschlossen ist - einen mehr als nur amtlichen Auftritt auf die Bretter legt. Die Setlist erweist sich als überaus ausgewogen und beinhaltet neben dem eröffnenden Hammer „Mirror, Mirror“ zur allgemeinen Überraschung unter anderem auch das aus der Ära mit Thomas Vikström am Mikro stammende „The Dying Illusion“, selbstredend aber auch Klassiker der Kategorie „Demons Gate“ und „At The Gallows End“. Der eher schlaksig anmutende Mats Leven mag zwar über nicht das Charisma eines Messiah Marcolin verfügen, an der Tatsache, dass Candlemass mit ihm einen absoluten Top-Frontmann in den Reihen haben, gibt es jedoch ebenso wenig Zweifel wie am Umstand mit den Schweden eines der Tages-Highlights gesehen zu haebn. Doom As Doom can!
Inwiefern es dem zu jenem Zeitpunkt offenbar mächtig angepissten Petrus zuzuschreiben ist, dass auf Grund der eher instabil wirkenden Wetterlage in den frühen Abendstunden des ersten Festival-Tages einige Zuseher mehr in die Halle strömen als erwartet, ist zwar schwer nachvollziehbar, würde aber ohnehin nichts am Umstand ändern, dass sich die Verpflichtung von Jean Beauvoir und seinem Gefolge als Gewinn für das Veranstalter-Team entpuppen sollte. Das Interesse an der erst vor kurzer Zeit reanimierten Melodic Rock-Legende Voodoo X ist nämlich auch so gewaltig und wird von der Formation mit entsprechender Spielfreude und einer überaus tighten Performance quittiert. Da auch die Eingängigkeit des Songmaterials immer noch gegeben ist, sieht (bzw. hört) man schon bald nicht nur jene Zeitgenossen lauthals mitsingen, die bereits zur ersten Blütephase des Unternehmens in den 80ern mit dabei waren, sondern auch den überraschend zahlreich vertretenen Nachwuchs. Generell fällt nämlich – und zwar nicht nur bei Voodoo X, sondern auch bei anderen, der „plüschigeren“ Abteilung zuzuordnenden Fraktion zählendenden Acts wie Dare oder Tyketto – beim diesjährigen Festival auf, dass offenbar eine neue Generation Fans für diese Kost herangewachsen ist. Und diese hat nicht nur die Heldentaten ihrer Idole bereits intus, sondern versteht es auch schon ganz im Stile der „Väter-Generation“ Bands entsprechend abzufeiern. Nicht zuletzt dadurch ist die Stimmung in der Halle am Siedepunkt als die Truppe mit Tracks wie „I’m On Fire“ oder „Happy Birthday“ das legendäre Voodoo X-Debüt „The Awakening“ zitiert. Songs wie diese verursachen nämlich immer noch mächtige Fan-Chöre, die mindestens ebenso beeindruckend sind, wie die gewöhnungsbedürftige Haarpracht des Band-Oberhaupts. Kurzum: ein überaus gelungenes Comeback!
Wer sich als Kontrastprogramm zu so viel Melodie lieber heftigsten Stoff um die Ohren ballern lassen mag, begibt sich abermals vor die Open Air-Bühne. Über die Co-Headliner-Rolle von Carcass ist zwar im Vorfeld viel diskutiert worden, als die vier Herrschaften jedoch vor ihrem Backdrop, das durchaus auch in der medizinischen Fakultät der Uni seine Berechtigung hätte, loslegen, ist von einem Stimmungsabfall nicht viel zu bemerken. Im Gegenteil, mit Fortdauer des Gigs verfolgen immer mehr den von einem bestens gelaunten Jeff Walker auf typisch britische Manier mit Charme und Humor be geleiteten Abriss, der unter anderem Kracher wie „Corporal Jigsore Quandary“ oder „Incarnated Solvent Abuse“ enthält. Neben Jeff ist wohl Bill Steer der für die Show zuständig, ist er doch ständig in Bewegung gibt permanent Vollgas. Kein Wunder also, dass die Herrschaften nach dem vielumjubelten „Heartwork“ schweißgebadet und ganz offensichtlich hochzufrieden die Bühne verlassen und ein zwar geplättetes, aber ebenso rundum zufriedenes Auditorium hinterlassen.
Auf der Indoor-Stage gibt es derweil abermals höchst melodische Klänge zu bestaunen, die beim Publikum auf reges Interesse stoßen. Nachvollziehbar, schließlich steht mit Dare eine Band auf der Bühne, die man äußerst selten zu Gesicht bekommt. Intensiviert wird die Neugierde wohl auch durch die Tatsache, dass die Formation nach langer Pause endlich wieder einmal ein neues Album veröffentlichen wird. Zwar kommt „Sacred Ground“ erst einen Tag nach diesem Auftritt auf den Markt, für Darren Wharton und seine Mannschaft bietet sich jedoch logischerweise eine ideale Möglichkeit ihr neues Material der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das wird auch entsprechend getan und da sich der Stoff fein in den Vortrag des älteren Materials einfügt, wird kein Zuseher enttäuscht sein. Im Gegenteil, man durchaus von einer Melodic Rock /AOR-Vollbedienung sprechen, die geboten wird, wobei allen voran der bestens gelaunte und auch stimmtechnisch in Topform agierende Darren Applaus erhält. Aber auch sein langjähriger Mitstreiter Vinny Burns wirkt bestens disponiert und überaus spielfreudig und hat die Meute fest im Griff. Zwar klingt die im späteren Verlauf des Sets eingeflochtene Interpretation von „Emerald“ ein wenig gewöhnungsbedürftig, ansonsten aber gibt es am Auftritt von Dare wahrlich nichts zu meckern.
Draußen steht inzwischen der Top-Act des Tages auf dem Programm, über dessen Headliner-Position es keine Debatte gab und gibt. Weshalb, wird spätestens nach dem Einstieg von Slayer mit den Doppelschlag „Repentless“ / „Disciple“ aber auch einmal mehr offenkundig. Was braucht es mehr als eine verdunkelten Himmel (Danke Petrus, stimmungsvoller kann man diese Herrschaften nicht inszenieren!), diabolisches Licht und vier Männer auf den Brettern die unterstützt von einem drückenden Sound ein Programm fahren, das einem Abriss der Sonderklasse gleichkommt. Während Kerry King auf der von der Band aus gesehen linken Bühnenseite in seiner unnachahmlichen Art die Saiten malträtiert, gibt Tom Araya einmal mehr den Ruhepol in der Mitte. Er mag sich zwar nur wenig bewegen, doch allein seine Ausstrahlung und Bühnenpräsenz reichen aus um die Tracks noch ein wenig brutaler wirken zu lassen. Eigenwillig mag für so machen Zuseher zwar immer noch das krasse Gegenteil davon am rechten Bühnenrand wirken, doch etwas Besseres als der unglaublich bewegungsfreudige und ständig quer über Bretter tobende Gary Holt hätte SLAYER nach dem tragischen Tod von Jeff Hanneman wahrlich nicht passieren können. Und zwar in jeder Weise, denn die Songs kommen nicht nur akustisch perfekt rüber, auch visuell passt alles zusammen. Egal, ob mit getragener Langsamkeit die an Intensität nicht zu überbieten ist („When The Stillness Comes“ entwickelt sich immer mehr zu einer Abrissbirne!), gediegener Brachialität (einmal mehr zum Hinknien: „Dead Skin Mask“), oder doch mit den ultra-heftigen Nackenbrechern der Frühzeit („Raining Blood“, „Angel Of Death“), das Publikum darf einmal mehr an einer wahren Machtdemonstration teilhaben. Und wenn, wie bei „South Of Heaven“, auch noch dunkle Wolken einen gespenstischen Kontrast zum blutroten Licht auf der Bühne entstehen lassen, ist das einfach nur ganz, ganz großes Kino!
Wer danach noch stehen kann, begibt sich abermals hurtig in die Messehalle. Bis weit nach Mitternacht darf sich dort zunächst das Pagan-Volk an Equilibrium ergötzen. Deren aktuelle Tracks kommen zwar deutlich epischer und atmosphärischer aus den Boxen als man es von der Formation gewohnt ist, der Großteil der dargebotenen Songs animiert die Meute aber dennoch vorwiegend zum gemeinsamen Hopsen. Ohne meine Anwesenheit (ihr wisst, ja, wie das ist mit dem Alter….) gibt sich danach für die Groove-Fraktion bei Ektomorf auch noch eine weiteren Test für die Belastbarkeit der Sprunggelenke. Keine Ahnung, wie gut besucht der Set der Magyaren tatsächlich war, einige wenige Anwesende zeigen sich am nächsten Tag jedenfalls davon gehörig angetan, vor allem von Frontmann Zoli, der es offenbar einmal mehr eindrucksvoll zustande brachte, alles und jeden zum Mitmachen zu animieren.